Meine SPD Anfänge
Das Jahr 1989
Spannend. Mein elfjähriger Sohn Martin war Thomaner in Leipzig. Er erzählte aufgeregt von einer Demonstration, Steine wurden geworfen, blutende Mädchen flüchteten in die Thomaskirche. Die Jungs mussten singen. Martin schlief danach zu Hause schlecht. Er sorgte sich um die Mädchen. Ich arbeitete an der Akademie der Künste, schrieb über Musik, analysierte Tonsysteme lebender Komponisten, eine wunderbare Arbeit. Die Nische konnte nicht schöner sein. Aber es gab die Gespräche mit den Eltern in Leipzig, mit dem Thomaskantor Hans-Joachim Rotzsch und auch die mit Erziehern des Alumnats, die ich nicht mochte. Und Martin mochte sie erst recht nicht. Es war klar: hier passiert etwas, es liegt etwas in der Luft, kann gut gehen oder auch nicht. Wir trafen uns nicht mehr nur in kleinen Kreisen, der Austausch kritischer Texte von Schriftstellern – mühsam mit der Schreibmaschine über blaues Kopierpapier abgeschrieben – wurde intensiver. Nächtelang habe ich abgeschrieben. Umweltschutz-Gedichte über Leuna und Buna, auch Volker Braun, Christa Wolf, Biermann. Es musste etwas passieren. Meine Leipziger Freundin Allmuth rief mich in Berlin an und riet mir, Martin von der Montagsdemo fern zu halten. In den Ställen der Pferderennbahn im Scheibenholz hatte man die Pferde durch medizinische Notambulanzen ersetzt, Blutkonserven. Allmuths Vater war Arzt. Meinen Sohn konnte ich in Leipzig telefonisch nicht erreichen. Wir hatten privat kein Telefon, als zuverlässige Staatsbürger wurden wir nicht eingeschätzt. Stundenlang stand ich in einer Telefonzelle, immer wieder von anderen Telefonierern rausgeworfen. Dann kam dieser 9. Oktober. In der Akademie der Künste fand eine sinnentleerte Veranstaltung zur aktuellen politischen Situation statt. Ich dachte an meinen Sohn. Wussten die hier wirklich nicht, was in Leipzig los war? Diese vielen Menschen der Montagsdemos sollten alle nur verblendet worden sein? War die Akademie wirklich noch ein Tor zur Welt, kulturell offen und kreativ aufmützig?

Ich war entsetzt von der Verlogenheit dieser scheinpolitischen Veranstaltung. Und ich liebte doch diese Akademie und meine wunderbare musikwissenschaftliche Arbeit. An diesem Abend lief ich lange Strecken zwischen der Luisenstrasse und Hohenschönhausen zu Fuß. Ich hatte Angst. Was war in Leipzig passiert, wo war Martin, ging es ihm gut? Wie konnte es sein, dass die Akademie der Künste die Zeichen der Zeit nicht verstand? Was war los mit meinen Kollegen, kritischen Geistern, politisch stets bestens informiert? Am nächsten Tag erfuhr ich: Martin war bei der Demo dabei. Bei den Thomanern betreute immer ein Abiturient einen Kleinen. „Möhre“ - Martins Chef – musste natürlich zur Demo und nahm den Kleinen mit. „Möhre“ war Klasse und hatte es bestimmt nicht einfach mit dem Bengel, und der wiederum erzählte mir haarklein den Liebeskummer von „Möhre“. Die Demo war großartig, ganz viele Leute, den Polizisten hatten sie Blumen in die Gewehrläufe gesteckt. Und jeder nahm eine Kerze mit. Das sah sehr schön aus im Dunkeln.
Von da an änderte sich mein Leben. Ich war bei den Berliner Demos dabei, interessierte mich für Demokratie jetzt, wendete mich enttäuscht von deren Rechtsruck ab und fand an der S-Bahn-Station Hohenschönhausen einen Zettel mit Telefonnummer, dass sich eine SDP gründen wolle. Ich rief an und erfuhr, dass ich selbst was machen müsse. Also trafen wir uns in meiner Wohnung im Schweriner Ring. Wir tranken Tee und aßen Plätzchen und dachten über die SDP nach. Das war Anfang November 1989. Gleich nach Öffnung der Mauer war ich die Erste im SPD-Büro in der Müllerstrasse, beäugt wie ein Ufo und Dietmar Staffelt fragte, ob wir einen Kopierer hätten, so was würde man brauchen, um Werbung für die SDP zu verteilen. Hatten wir nicht. Und ein Büro wäre nötig – wieso, wir trafen uns doch in unserer Wohnung! Und Angestellte, Mitarbeiter, Öffentlichkeitsarbeiter? Nee. Hatten wir nicht. Ich glaube, Dietmar hatte in seinem ganzen Leben noch nie einen so blauäugigen Menschen wie mich gesehen.
Dann fanden wir uns - Renate Hofmeister, Konrad Elmer und all die anderen, die in ihren Wohnungen mit Gleichgesinnten Tee getrunken hatten. Noch im Herbst 89 schrieben Wolfgang Thierse, Iris Schälicke und ich ein Berliner Kulturkonzept – alles müsse erhalten bleiben, weil es ja genau so viele Menschen im vereinten Berlin geben werde, weil man Singakademien und Orchester nicht einfach fusionieren könne, weil das große Berlin alle Museen bräuchte. Die Akademie der Künste müsste wieder ordentlich Kunst fördern und Freiheit wäre jetzt das wichtigste Gut für Künstler, ganz ohne Angst.
Ich lege Wert darauf, SDP-Mitglied gewesen zu sein. Die Ausweise gab es erst 1990 und da steht „SPD“ drin. Das wollte ich eigentlich nicht. Ich dachte, es müsse einen Ostweg geben.
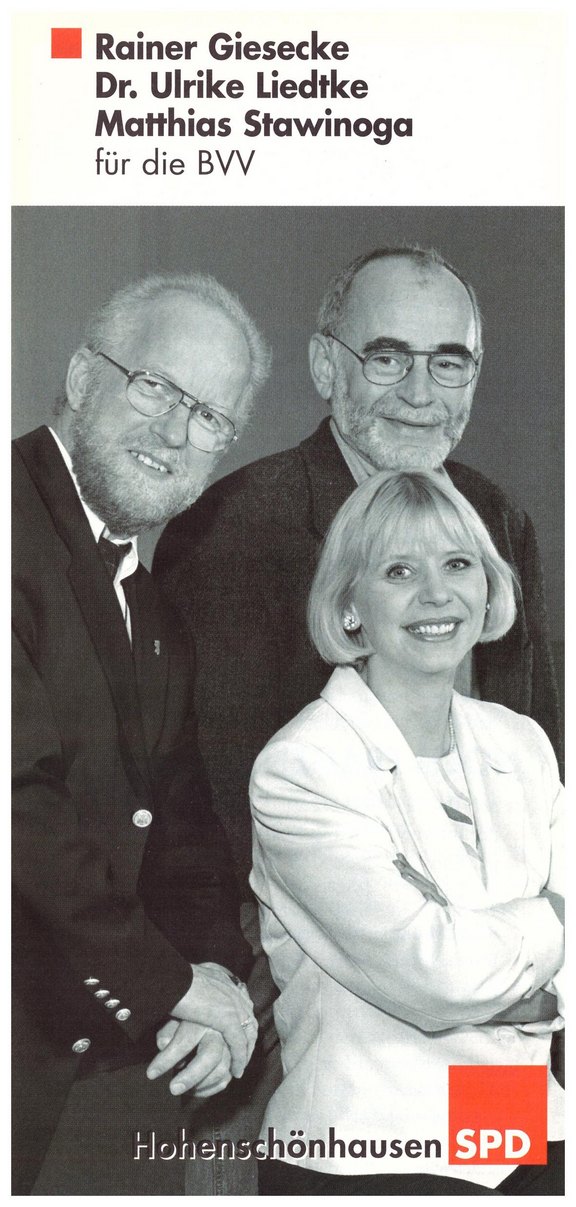
Die ersten Jahre
Ganz klar: Partei ging ja gar nicht. Zu viele Emporkömmlinge hatte ich erlebt, die über ihre Partei Karriere gemacht hatten. Das wollte ich nicht. SDP-Mitglied aus der Wende-Zeit heraus war okay, aber SPD-Mitglied??? Ich kann gar nicht sagen, wie viele Gespräche kluge SPD-Genossen mit mir geführt haben. Ich wollte nicht. Schon allein dieses Wort „Genosse“ kam gar nicht in Frage. Aber wir hatten ja keinen Kopierer, keinen Mitarbeiter, keine Öffentlichkeitsarbeit… Schlecht war mir nach meinem SPD-Beitritt, kotzübel. Niemals wollte ich so sein wie die Politiker, die ich in DDR-Zeiten erlebt und erfolgreich ignoriert hatte. Niemals. Dann kam die erste BVV-Wahl, ich fuhr das beste Stimmenergebnis in Hohenschönhausen ein. Plötzlich war ich in der Pflicht.
Der erste und beste Eindruck: In der Fraktion saß ich zusammen mit Menschen unterschiedlichster Berufe. Ich kam doch von der hehren Kunst! Ich kannte doch nur solche, die auch von der hehren Kunst kamen! Begeistert stellte ich fest, wie schlau die alle waren, ganz ohne Noten lesen zu können – die Pfarrersfrau Renate Hofmeister, der polnische Bauingenieur Jacek Gredka, die Finanzerin Dorette Suhr, der Umweltschützer Matthias Stawinoga. Renate räumte mit dem Stasi-Gefängnis Hohenschönhausen auf, Jacek las meine Gedichte und wollte immer neue, Dorette beäugte alles aus kühl monitärer Sicht, Matthias suchte Verbündete für den grünen Gürtel um Berlin, keine Bebauung nach Brandenburg, stattdessen ein Luftholen zwischen der Großstadt und dem Gebiet drumrum. Ihm verdanken wir heute, dass nördlich von Berlin nicht gebaut werden durfte.
Eine besondere Erinnerung gibt es: Als SPD-Fraktionsmitglied und dann als BVV-Vorsteherin hatte ich wöchentliche Sprechstunden im Rathaus zu absolvieren. Einmal kamen Bauarbeiter, sehr viele. Sie hatten die neuen Overalls an, Babystrampelanzüge haben wir damals gesagt. Und sie haben geschimpft. Auf alles und ganz laut und auf uns, die neuen Politiker. Und dann fiel der eine Satz, der mich seither verfolgt: IHR SEID JETZT AN DER MACHT. NUN MACHT WAS DRAUS. Also: ich, Renate, Jacek, Dorette… Wir waren jeden Abend im Rathaus, es gab einfach zu viel Arbeit. Aber über MACHT hatten wir nicht nachgedacht.
Die stärkste Kraft - PDS
Der Anfang war ganz schwer. Um die Ecke stand das Hohenschönhausener Gefängnis. Ich erinnere mich an eine Veranstaltung, zu der wir Joachim Gauck von der Stasi-Unterlagen-Behörde eingeladen hatten. Der Speisesaal des Hohenschönhausener Rathauses war rappelvoll - mit Stasimitarbeitern und Stasiopfern. Die Einen meinten, nur ihre Arbeitsaufträge umgesetzt zu haben und die Anderen erzählten blockierte Biografien. Und immer stand dazwischen Hass, Wut, die drohende Handgreiflichkeit. Ich bewunderte Gauck für seine Geradlinigkeit in dieser brezligen Situation. In der Kaufhalle habe ich mir dann die Leute an der Kasse vor mir und hinter mir angeguckt und immer überlegt, wer Wärter im Gefängnis gewesen sein könnte. Alles war ganz nah und mit jeder persönlichen Geschichte noch näher. Ein Zusammengehen mit der PDS ging gar nicht. Wir konnten nur nach bestem Wissen und Gewissen in der BVV arbeiten, Abend für Abend, meist bis in die Nacht hinein. So lange sich die PDS nicht von ihrer Vergangenheit distanzierte ging nichts. Das verstanden die in der Müllerstrasse nicht. Das konnten sie wahrscheinlich auch nicht verstehen. Erst allmählich ließ sich pragmatische Zusammenarbeit herstellen. Ganz konkret am Gegenstand eines BVV-Antrags lag man ja gar nicht weit voneinander weg.
Die Visionen von damals
Neue Schulen hatten wir gebaut, der Flächennutzungsplan beinhaltete den grünen Gürtel im Norden von Berlin, Galerien nahmen ihre Arbeit auf, das alte Handelshaus wurde durch das Lindencenter ersetzt, ein Kino gebaut und die Wohnungssanierung ließ Neubaublöcke bunt und schick erscheinen. Hohenschönhausen sollte lebenswert werden, individuell, modern, mit guter Sicht aus dem 12. Stock auf Berlin. Von Stadtrand war nicht die Rede. Wir wohnten ja gern dort – das warme Wasser kam aus der Wand, Badewanne, Fernheizung. Wir hatten Kinder, achtzügig waren die Klassenjahrgänge an den Schulen. HohenSCHÖNhausen. Geschichtlich konnten wir auf das 13. Jahrhundert verweisen, Schönhausener Siedler aus der Altmark hatten ein schönes neues Zuhause rund um die spätromantische Taborkirche gefunden, ihr Bau begann 1230.
Inzwischen gibt es schönere Ecken in Berlin. Aber gerade für junge Leute bietet das Neubaugebiet Chancen. S-Bahnanbindung zum Stadtzentrum und in Richtung Norden ist man schnell mit dem Fahrrad an Seen und in märkischer Idylle. Ich wünsche Hohenschönhausen Selbstbewusstsein, gesunde Stadtrandüberlegenheit und individuelle Gestaltungen.
30 Jahre danach
Das ist eine lange Zeit, eine sehr lange Zeit, mehr als ein Vierteljahrhundert. Meine Kinder sind groß geworden und haben eigene Kinder gekriegt. Wenn ich heute lese, wie es damals war, bestätigt sich ein Gefühl: es war die spannendste Zeit meines Lebens! Der komplette Umbruch – politisch, beruflich, selbst die Freunde wechselten. Mir erscheinen die Jahre 1989/1990 länger als alle anderen Jahre danach, weil sie so reich gefüllt waren mit Neuem. Noch immer begreife ich die friedliche Revolution als Chance, selbst zu gestalten. Manchmal klappt es, manchmal kämpfe ich gegen Verkrustungen, die es nach 30 Jahren gibt. Mich ärgert eine neue Arroganz der Macht in Ministerien - wenn der Herr Beamte stolz verkündet, wie viele Minister er schon überlebt habe. Wenn ich trotz Studium und Promotion zu doof zum Ausfüllen von Formularen bin. Wenn ich im Wahlkampf Stellung beziehen muss zum Waffenhandel Deutschlands, zur Braunkohle in der Lausitz, zum ungleichen Ost-West-Rentensystem, zur Ballung von Reichtum und zum Traum vom kostenlosen Kitaessen.
Es gibt noch viel zu tun!
Prof. Dr. Ulrike Liedtke
Mitglied des Landtags Brandenburg
Musikwissenschaftlerin, Gründungsdirektorin der Bundes- und Landesmusikakademie Rheinsberg, Autorin von Theaterstücken und Buchpublikationen zur zeitgenössischen Musik und zur Musik des 18. Jahrhunderts
